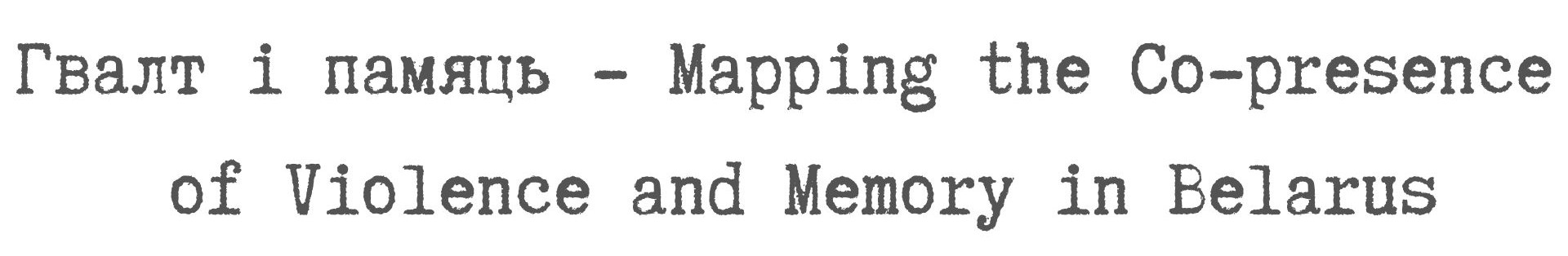Die Konzentrationslager bei Azaryčy
Christoph Rass & René Rohrkamp
Die Konzentrationslager bei Azaryčy wurden am 12. März 1944 im Operationsgebiet der 9. Armee der Wehrmacht (Heeresgruppe Mitte) angelegt, ca. 120 Kilometer südlich der Stadt Babrujsk in Belarus. Sie existierten jedoch lediglich bis zum 19. März desselben Jahres, denn ihr einziger Zweck bestand darin, dass sich die 9. Armee während eines koordinierten militärischen Rückzugs derjenigen Zivilisten entledigen konnte, die sie für „arbeitsunfähig“ erachtete. Diese Zivilisten wurden systematisch im gesamten Armeegebiet erfasst, in ein System frontnaher Lager bei Azaryčy deportiert und schließlich dort zurückgelassen, so dass sie ins Niemandsland zwischen den sich zurückziehenden deutschen Truppen und der sich auf dem Vormarsch befindlichen Roten Armee gerieten.
Die Lager bei Azaryčy unterscheiden sich in einigen Merkmalen signifikant von anderen Konzentrations- und Todeslagern bzw. Ghettos. Zum einen fehlen Zwangsarbeit oder systematische Mordaktionen, während die Lager selbst nur über eine eher kurze Zeitspanne existierten. Zum anderen lassen sie sich nur unter Berücksichtigung ihrer engen Verflechtung mit der militärischen Situation der 9. Armee, als auch der Lage der deutschen Truppen und ihren Besatzungs-, Ausbeutungs- und Vernichtungsstrategien zu Beginn des Jahres 1944 verstehen.
Es handelt sich also um eine Geschichte, die eng mit dem Schicksal der Zivilbevölkerung unter deutscher Herrschaft verknüpft ist, die sich mit Beginn der deutschen Rückzugsbewegungen und der damit verbundenen Zwangsevakuierungen in wachsender Anzahl im schrumpfenden deutschen Machtbereich zusammendrängte. Anfang 1944 entwickelte die 9. Armee der Wehrmacht eine radikale Lösung für das von ihr selbst hervorgebrachte Problem. In einer systematisch geplanten, groß angelegten Operation sollten all jene verbliebenen Zivilisten, die von der Wehrmacht als „arbeitsunfähig“ eingestuft wurden, aus dem deutschen Machtbereich deportiert und in drei Konzentrationslagern untergebracht werden, die einzig zu diesem Zweck so unmittelbar hinter der deutschen Hauptkampflinie errichtet wurden, dass sie nach einer ebenfalls geplanten „Frontbegradigung“ im Niemandsland zwischen den deutschen und der sowjetischen Stellungen liegen würden.
Im März 1944 standen die Einheiten der 9. Armee in einem Umkreis von rund 60 bis 70 Kilometern östlich der Stadt Babrujsk. Zu ihren Kampfverbänden zählten das LV. Korps mit der 20. und der 5. Panzerdivision, das XXXV. Korps mit der 383., 6. und 45. Infanteriedivision, das XXXXI. Korps mit der 36. und 253. Infanteriedivision und der 4. Panzerdivision sowie wie das LVI. Korps mit der 134., 110., 35. und 129. Infanteriedivision. Während die Lager selbst im Sektor des LVI. Korps angelegt wurden, so dass den Divisionen dieses Verbandes eine tragende Rolle bei der Umsetzung dieses Kriegsverbrechens zukam, beteiligten sich alle Korps und Divisionen der Armee an den Deportationen in die Lager bei Azaryčy.
Verursacht wurde die dramatische Situation im Sektor der 9. Armee während des Winters 1943/44 vor allem durch die deutsche Besatzungspolitik und die Art und Weise, in der sich Wehrmacht aus Gebieten zurückzog, die sie nun preisgeben musste. Seit 1941 hatte die Rekrutierung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern dazu geführt, dass im Operationsgebiet der Wehrmacht kaum noch leistungsfähige Männer und Frauen zurückblieben, sondern nur noch deren nicht „arbeitsfähige“ abhängigen Angehörige, die nicht für sich selbst sorgen konnten – der demographische Schatten des deutschen Zwangsarbeitssystems. Da beim Rückzug der Wehrmacht die verbliebene Zivilbevölkerung nicht zurückbleiben sollte, schob die Wehrmacht auf ihrem Weg nach Westen eine zunehmend große Masse hilfloser Zivilisten vor sich her.
Anfang März 1944 genehmigte Adolf Hitler eine Frontbegradigung innerhalb des Befehlsgebiets der 35. Infanteriedivision, da die deutsche Hauptkampflinie eine ostwärts gerichtete Spitze bildete, die kaum zu verteidigen war. Dies gab der 9. Armee Gelegenheit, ihren radikalen Plan auszuführen: Die Deportation derer aus ihrem gesamten Besatzungsgebiet, welche die Wehrmacht als „überflüssige“, weil „arbeitsunfähige“ Zivilisten betrachtete.
Sofort im Anschluss an die Genehmigung der Absetzbewegung begann die 35. Infanteriedivision das erste Lager anzulegen.[i] General Josef Harpe, Oberbefehlshaber der 9. Armee, der die Zwangsrekrutierung ziviler Arbeitskräfte für den Bedarf der Wehrmacht und der Rüstungsindustrie 1943 und 1944 energisch vorangetrieben hatte und sich der demographischen Konsequenzen solcher Vorgehensweisen vollkommen bewusst war,[ii] gab mit dem Befehlt Nr. 233/44 den Rahmen der Operation vor. Der Befehl sah vor, dass am 12. März um 4 Uhr morgens eine Operation anlaufen sollte, die alle „arbeitsunfähigen“ Personen in den Frontabschnitt bei Azaryčy zu deportieren seien, aus dem sich die Wehrmacht kurz darauf zurückziehen würde. Neben der Vorstellung, Zivilisten aus dem eigenen Befehlsbereich abzuschieben, die sich als eine „Belastung“ erwiesen hatten, spielte die Furcht der deutschen Besatzer vor der Ausbreitung einer Fleckfieberepidemie eine entscheidende Rolle. Man entschied sich in der Hoffnung, dadurch die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen dazu, auch alle erkrankten Zivilisten in die Lager zu deportieren.[iii]
Mit der Organisation und Durchführung der Operation wurden sowohl auf Ebene der Armee- bzw. Panzerkorps als auch auf Ebene der Divisionen die jeweiligen Quartiermeisterabteilungen betraut. Beteiligt waren neben den Divisionstruppen, Verbände, die den Korps direkt unterstanden sowie 150 Mann des Sonderkommandos 7a der Einsatzgruppe B der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS (SD).
Aufgrund der lokalen Gegebenheiten sowie der Verfügbarkeit von Transportmitteln sollten das LVI. und das XXXXI. Panzerkorps, deren Divisionsabschnitte sich im Süden des Sektors der 9. Armee am nächsten zur geplanten Absetzzone befanden, die von ihnen zusammengetriebenen Zivilisten zu Fuß oder mit Lastkraft- bzw. Pferdewagen zu den Lagern bringen. Dem XXXV. und LV. Armeekorps dagegen, die weiter nördlich und am weitesten vom vorgesehenen Lagerkomplex entfernt lagen, stand das Eisenbahnnetz für den Transport der Zivilisten zur Verfügung. Neben diesen organisatorischen Belangen regelte der Befehl die Unterstellung aller für den Transport der Zivilisten vom Ausladebahnhof zu den „Endlagern“ beteiligten Wehrmachtseinheiten unter das Sonderkommando 7a.[iv] Jenseits der Regelung organisatorischer Fragen legte der Befehl vom 9. März 1944 außerdem fest, dass die eigene Artillerie bei der Zurücknahme der eigenen Hauptkampflinie die Lager durch Sperrfeuer abschirmen sollte, um Zivilisten an der Flucht in Richtung der deutschen Linien zu verhindern.[v]
Im Zielgebiet der Deportationen wurde umgehend ein System eingezäunter Areale errichtet, in denen sich keine Gebäude oder sanitären Anlagen befanden. Es sollte dazu dienen, die Zivilisten zusammenzufassen und ihren Transport über die letzten Kilometer zu den drei Endlagern zu ermöglichen. Die 129. Infanteriedivision legte in der Nähe des „Ausladebahnhofs“ Rudabielka, dem eine Schlüsselposition für den Eisenbahntransport zukam, ein Sammellager an. Das Lager sollte 6 000 Menschen umfassen. Tatsächlich wurden dort zwischen dem 13. und 15. März etwa 12 000 bis 16 000 Menschen zusammengepfercht. Von dort sollte der Weitermarsch über ein Zwischenlager in das sogenannte „Endlager Süd“ erfolgen, das von der 35. Infanteriedivision mit einer Kapazität zur Aufnahme von etwa 12 000 Menschen angelegt wurde. Das Sonderkommando 7a des SD übernahm, unterstützt von Wehrmachtseinheiten, die Bewachung der Zivilisten während der letzten Phase der Operation, dem Fußmarsch vom „Ausladebahnhof“ in die Endlager.
Neben dieser Hauptachse für den Transport der Zivilisten legten die 35., die 129. und die 110. Infanteriedivision kleinere Zwischenlager in der Nähe der Dörfer Niastanavičy, Paraslišča und Mikuĺ-Haradok an, um die Zivilisten aus den Sektoren des LVI. und das XXXXI. Panzerkorps aufzunehmen. Später wurden sie in die für sie vorgesehenen „Endlager I“ bei Myslaŭ Roh bzw. in das „Endlager II“ bei Licvinavičy getrieben.
Das größte der sogenannten „Endlager Süd“ bei Dzierć bestand aus einem zweifachen Stacheldrahtzaun mit improvisierten Wachtürmen und lag in einem bewaldeten Sumpfgebiet. Um die Rote Armee nicht vor dem geplanten Rückzug auf die Operation aufmerksam zu machen, war den Zivilisten trotz der empfindlichen Kälte das Entfachen von Feuern verboten. Gemäß der Operationspläne, auf denen der Befehl vom 9. März 1944 beruhte, verfolgte die Wehrmacht die Absicht etwa 20 000 „Seuchenkranke, Krüppel, Greise und Frauen mit mehr als 2 Kindern unter 10 Jahren sowie sonstige Arbeitsunfähige“ aus dem Sektor der 9. Armee in die drei „Endlager“ zu deportieren.[vi]
Jedoch zeigt die Analyse der verfügbaren Quellen, dass schon innerhalb des Bereichs der nördlich agierenden XXXV. und LV. Armeekorps mindestens 30 873 Personen für die Deportation ausgewählt wurden, von denen schließlich 23 519 mit dem Zug nach Rudabielka gebracht wurden. Die Eisenbahntransporte umfassten damit bereits die doppelte Zahl an Zivilisten als zunächst im Befehl vorgesehen. Dementsprechend und da sich die vorgesehenen Lebensmittelzuteilungen als ebenso unzureichend erwiesen wie die verfügbaren Transportmittel, verschlechterten sich die Bedingungen für die Zivilisten während der Transporte und in den Lagern dramatisch. Zudem schloss die Wehrmacht als Maßnahme gegen die Fleckfieber-Epidemie all jene Zivilisten in die Deportation mit ein, die sich im Armeegebiet bereits infiziert hatten und in sogenannten „Seuchendörfern“ unter unsäglichen Bedingungen in Quarantäne gehalten wurden. Insgesamt wurden etwa 7 000 erkrankte Personen in die Lager gebracht. Dort wurden sie nicht von den noch gesunden Opfern getrennt. Gekoppelt mit den katastrophalen Lebensbedingungen führte dies zu einer epidemischen Ausbreitung der Krankheit in den Lagern sowie zu einer extrem hohen Todesrate unter jenen, die sich ansteckten.
Das Kriegstagebuch der Quartiermeisterabteilung des LVI. Korps enthält Informationen über die Befüllung der Lager zwischen 14. und 16. März. Es hält fest, dass eine Gesamtzahl von 39 597 erwachsenen Zivilisten und zusätzlich „einigen Tausend Kleinkinder“ in die drei Endlager deportiert wurden.[vii] Das Sonderkommando 7a ermittelte in seinem Bericht eine Gesamtzahl von 47 461 Personen.[viii] Nach der Befreiung der Konzentrationslager sprach die Rote Armee von 33 000 Überlebenden und 9 000 Toten.[ix] Es ist nicht möglich, die Genauigkeit dieser Zahlen zu überprüfen, insbesondere, da die vielen Kinder und Kleinkinder unter den Opfern von den Deutschen nicht systematisch gezählt wurden. In einer Zusammenschau verweisen die Quellen auf die Deportation von bis zu 50 000 Menschen.
Die Deportationen erfassten insgesamt ein Gebiet von etwa 5 000 Quadratkilometern. Allerdings gehörten die Deportierten nicht ausnahmslos zu der im Sektor der 9. Armee ursprünglich ansässigen Bevölkerung. Viele Opfer waren bereits aus verschiedenen Regionen der von Deutschland besetzten Teile der Sowjetunion dorthin vertrieben worden. Einige waren bei den jüngsten Rückzugsbewegungen der 9. Armee evakuiert worden; andere befanden sich seit Wochen in unterschiedlichen Lagern der Wehrmacht. So berichtete eine Überlebende als Zeugin im Minsker Kriegsverbrecherprozess, wie sie bereits im Dezember 1943 von der Wehrmacht aus ihrem Dorf vertrieben worden war. Nach der Selektion der Arbeitsfähigen aus den Überlebenden dieser Aktion wurde sie in ein weiteres Lager eingeliefert, in dem offenbar Wehrmachtsärzte Menschenversuche zur Fleckfieberforschung durchführten. Von dort wurde sie in ein Lager bei Paraslišča, etwa 20 km nordwestlich des Lagerkomplexes von Azaryčy verbracht, um im März 1944, nach einer viermonatigen Odyssee, schließlich in eines der dortigen „Endlager“ deportiert zu werden.[x] Wieder andere Zivilisten stammten aus Dörfern in der unmittelbaren Umgebung der Lager.[xi]
Über das Verhalten der Wachmannschaften sowie der Soldaten im Verlauf der Operation berichteten Überlebende, dass bereits beim Zusammentreiben der Menschen durch die Divisionseinheiten auf Fluchtversuche und Widerstand mit brutaler Gewalt reagiert wurde. Das Sonderkommando 7a selbst dokumentierte die exzessive Brutalität und das Töten zwischen „Ausladebahnhof“ und „Endlager“ minutiös. Auf dem Marsch übernahmen Angehörige des Sonderkommandos 7a die Bewachung der Kolonne an der Spitze und am Schluss, während die Wehrmachtseinheiten an den Flanken marschierten.[xii]
Menschen, die auf dem Marsch nicht mit den anderen mithalten konnten, wurden von den Begleitmannschaften rücksichtslos ermordet. Über ihre Zahl liegen keine genauen Angaben vor, die 9. Armee selbst räumte in ihrem Erfahrungsbericht allerdings ein, dass allein auf dem Bahntransport etwa 500 Menschen ums Leben gekommen waren.[xiii] Sie riet auch dazu, bei ähnlichen Operationen künftig hinter den Marschkolonnen Beerdigungskommandos marschieren zu lassen, um die Leichen der Getöteten zu beseitigen.[xiv] Auch in den Lagern selbst schossen die Wachmannschaften ohne Vorwarnung auf Menschen, die sich auf der Suche nach Wasser dem Zaun näherten. Ebenso wurde auf Versuche, Feuer zu entfachen, durch die in den Wachtürmen postierten Deutschen mit dem Beschuss der Beteiligten reagiert.[xv]
Wehrmachtseinheiten – insbesondere die Versorgungstruppen – waren in all diese Handlungen aktiv involviert.[xvi] Für den Transport in das Konzentrationslager in Dzierć unterstanden die Begleitmannschaften der Züge, die in Rudabielka eintrafen, und „besonders resolute Offiziere, Unteroffiziere und Männer“ des LVI. Panzerkorps direkt dem Sonderkommando 7a.[xvii]
Die Aussagen Überlebender zeichnen ein grauenvolles Bild der Wirklichkeit während der Märsche und in den Lagern. Auch den Tätern stand die Inhumanität ihres Handelns vor Augen. So spiegelt der Tagebucheintrag eines deutschen Militärgeistlichen die Situation wieder, die er vorfand, als er sich dem „Endlager Süd“ bei Dert näherte, in dem zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 20 000 Zivilisten interniert waren:
„Ich spürte die Veränderung zuerst an einem seltsamen erregenden Geräusch, welches ich nicht näher bestimmen konnte, bis ich in der Ferne das Lager entdeckte. Ein ununterbrochenes leises Wehklagen vieler Stimmen stieg daraus zum Himmel auf. Und dann sah ich, wie man gerade vor mir die Leiche eines alten Mannes abschleppte wie ein Stück Vieh. Man hatte einen Strick um sein Bein gebunden. Eine Greisin lag tot am Wege mit frischer Schusswunde in der Stirn. Ein Posten der Feldgendarmerie belehrte mich weiter. Er wies auf ein paar Bündel im Dreck hin: Tote Kinder, über die er ein Kissen gelegt hatte. Frauen haben ihre Kinder, die sie nicht mehr tragen konnten, am Wege liegen lassen. Auch sie wurden erschossen, wie überhaupt alles ‚umgelegt‘ wird, was wegen Krankheit, Alter und Schwäche nicht mehr weiter kann.“[xviii]
In den Divisionsbereichen wurden die Deportationen Trupps der Feldgendarmerie gemeinsam mit den Einheiten in den rückwärtigen Divisionsbereichen, die den Quartiermeistern unterstellt waren, durchgeführt. Im Einvernehmen mit dem Befehlshaber des Sonderkommando 7a – SS-Sturmbannführer Helmuth Looss – übernahm die 110. Infanteriedivision die Überwachung der nördlichen Zwischen- und Konzentrationslager. In den ersten Tagen der Operation bewachte die Division die Zivilisten aus dem Bereich des XXXXI. Panzerkorps im „Zwischenlager Nord“ bei Mikuĺ-Haradok und setzte die Lastwagen ihrer eigenen Transportkolonne für die Verbringung von Zivilisten ins „Zwischenlager Mitte“ bei Paraslišča ein. Das Sonderkommando 7a indes konzentrierte sich auf die Südroute, die Hauptachse der Deportation, auf der sich die meisten Zivilisten bewegten. Zur Bewachung der Lager wurden außerdem die Versorgungstruppen und die Feldersatzbataillone der 129. und 110. Infanteriedivision sowie Reserveeinheiten der Armeewaffenschule und der 35. Infanteriedivision hinzugezogen.
Nach Abschluss der Transporte der Opfer in die Lager wurden deren Eingänge mit Minen gesperrt. Die Wehrmachtseinheiten zogen ab und ließen nur einige kleine Wachkommandos zurück. Am 17. März 1944 zogen sich auch diese letzten verbliebenen Wachen auf die neue Hauptfrontlinie der 35. Infanteriedivision zurück, wobei sie die Lager unter Beschuss nahmen, um die Internierten an der Flucht zu hindern.
Am 19. März entdeckten Aufklärungseinheiten der Roten Armee die drei „Endlager“ bei Azaryčy. Nach der Räumung der deutschen Minen, denen nach dem Rückzug der deutschen Wachen bereits zahlreiche Lagerinsassen beim Versuch, die Lager zu verlassen, zum Opfer gefallen waren, brachte man die Überlebenden in eine Reihe teils improvisierter Lazarette in der Umgebung gebracht. Die 9. Armee der Wehrmacht gab in ihrem Abschlussbericht an die Heeresgruppe Mitte an, dass Aufklärer der Luftwaffe beobachtet hätten, wie die Überlebenden einige Tage später ins sowjetische Hinterland transportiert wurden.[xix]
Als das Ausmaß der Deportationen nahm die so genannte „Außerordentliche Kommission“, die auf sowjetischer Seite deutsche Kriegsverbrechen dokumentierte, sogleich ermittlungen auf und sicherte Beweismaterial. In ihrem Bericht vom 6. Mai 1944 forderte die Kommission, dass gegen die elf deutsche Offiziere, die für das Verbrechen verantwortlich gemacht wurden, Anklage erhoben werde. Im Rahmen der Nürnberger Prozesse legte Oberjustizrat Smirnow, der die UdSSR in der Anklage vertrat, im Februar 1946 einen ausführlichen Bericht als Beweismittel vor.[xx]
Im Rahmen eines sowjetischen Kriegsverbrecherprozesses in Minsk wurde zudem General Johann-Georg Richert, Kommandeur der 35. Infanteriedivision, der bei Kriegsende in sowjetische Gefangenschaft geraten war, die zum Tode verurteilt. Er war unter anderem wegen seiner Rolle bei den Deportationen von Azaryčy angeklagt und wurde am 30. Januar 1946 in Minsk hingerichtet. Weitere Offiziere und Mannschaften, denen eine Beteiligung an den Deportationen nachgewiesen wurde, wurde während ihrer Kriegsgefangenschaft der Prozess gemacht. Viele von ihnen wurden zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Die meisten Täter jedoch, die unmittelbar verantwortlich für die Planung und Ausführung der Deportationen von Azaryčy waren, an erster Stelle Helmut Looss, „Führer“ des Sonderkommandos 7a, Josep Harpe, Oberbefehlshaber der 9. Armee, Friedrich Hoßbach, kommandierender General des LVI. Korps und ebenso Werner Bodenstein, der Oberquartiermeister der 9. Armee, wurden für ihre Verbrechen nie zur Verantwortung gezogen.
Übersetzung aus dem Englischen
Cornelia Kastelan
Quellen
Die Ereignisse in Azaryčy sind in den Unterlagen der Wehrmacht gut dokumentiert. Belege finden sich in verschiedenen Arten von Einsatzdokumenten, die sich sowohl mit militärischen Aktionen als auch mit Verwaltungsentscheidungen befassen. Die wichtigsten Quellen waren drei Feldberichte, die Aufschluss über die Beweggründe für die Operation sowie über ihre Ziele und Durchführung geben. Der Feldbericht der 9. Armee bietet den klarsten Einblick, da er auf den Berichten der unterstellten Einheiten beruht, von denen nur noch die des LV. Armeekorps und des Sonderkommandos 7a des SD existieren. Der Feldbericht des Beratender Hygieniker der 9. Armee liefert ergänzende Informationen aus militärmedizinischer Sicht.
Die militärischen Protokolle der LV. Armee und des XXXXI. und LVI. Panzerkorps sind ebenfalls noch vorhanden. Sie enthalten wichtige Informationen und Kommentare zu der Operation. Der Befehl der 9. Armee, der die Durchführung der Operation anordnete, ist nicht mehr im Original vorhanden, da er aufgrund eines Zusatzbefehls nach Abschluss der Operation vernichtet werden musste. Der Inhalt des Befehls ist jedoch im militärischen Protokoll der Quartiermeisterabteilung des LVI. Panzerkorps detailliert festgehalten, einschließlich der ergänzenden Befehle, die der Quartiermeister dieses Korps bei der Planung der Einzelheiten ausgearbeitet hat. Die militärischen Protokolle vermitteln auch einen genauen Eindruck von der institutionellen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Einheiten. Einer der wertvollsten Funde sind zwei Karten mit unterschiedlichem Maßstab, die das Gebiet zwischen Chojna – westlich des Flusses Pcič – und Marmavičy zeigen, das vom LVI. Panzerkorps gehalten wurde und den Schwerpunkt der Operation bildete. Auf diesen Karten sind die Standorte der Divisionen und Korps, die Aktivitäten der Partisanen und das Netz der Transportwege und Lager eingezeichnet, die an der Massendeportation beteiligt waren.
Informationen über die Deportation auf Divisionsebene sind nur aus den wenigen erhaltenen Unterlagen einer Infanteriedivision verfügbar. Umfassende Unterlagen über einige der für die Operation verantwortlichen Offiziere finden sich in Personalakten und in einigen Gerichtsakten.
Im Nationalarchiv der Republik Belarus in Minsk und in den ebenfalls dort befindlichen Archiven des belarusischen KGB werden Vernehmungsprotokolle aufbewahrt, die Aussagen von Wehrmachtsangehörigen enthalten, die später zu sowjetischen Kriegsgefangenen wurden. Darüber hinaus gibt es Gerichtsprotokolle, die während des Prozesses in Minsk gegen den Kommandeur der 35. Infanterie-Division Johann-Georg Richert angefertigt wurden. Neben seinen Aussagen über die Operation gibt es auch Zeugenaussagen von Überlebenden der Deportationen.
Darüber hinaus enthalten die belarussischen Regionalarchive, wie das Regionale Staatsarchiv in Žlobin, fragmentarische Unterlagen aus erbeuteten deutschen Akten. Informationen über die Ereignisse im Zusammenhang mit der Evakuierung von Žlobin liegen nur in Form von mündlichen Aussagen vor, die von Zeugen vor Ort einige Wochen nach der Befreiung des Lagers gemacht wurden und von denen einige veröffentlicht worden sind.
Im Belarusischen Staatsarchiv für Filme, Fotografien und Tonaufnahmen in Dziaržynsk existieren Fotografien und Filmaufnahmen, die die Rote Armee während der Befreiung des Lagers bei Azaryčy gemacht hat. Sie dokumentieren auch die Bedingungen in der Umgebung im März 1944.
Ein besonders wertvolles zeitgenössisches Dokument, das die Diskrepanz zwischen „Täter-“ und „Opfer-“Perspektive verdeutlicht, ist der Eintrag des Divisionskaplans, der sich während der intensivsten Phase der Operation zufällig im größten Konzentrationslager (Endlager) in der Nähe des Dorfes Dzierć befand und dort Zeuge der Deportationen wurde.
Nur Auszüge aus den vom Obersten Justizrat Smirnow während des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher im Jahr 1946 erstellten Beweisunterlagen – Dokument Nr. USSR-4 – sind in den veröffentlichten Protokollen dieses Prozesses verfügbar, aber eine vollständige Kopie dieses Dokuments befindet sich im Staatsarchiv Nürnberg.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg
- H 20 5 8.
- Msg 109/946.
- RH 20 9 197.
- RH 24 55.
- RH 26 45.
- RH 26 253 G.
Nationale Verwaltungsstelle für Archivgut und Unterlagen, Washington
- NARA T-314 Film 1440.
- NARA T-314 Film 1438.
- NARA T-314 Film 1440.
- NARA T-314 Film 688.
- Nara T-314 Film 990.
Nationalarchiv der Republik Belarus, Minsk
- Fond 4.
- Fond 1363, Opis 1.
Privatarchiv Paul Kohl, Berlin
- Vernehmung von Generalleutnant Johann Georg Richert am 16. Januar 1946.
Staatsarchiv Nürnberg
- USSR-4.
Literatur
Obwohl die Deportationen von Azaryčy seit den Nürnberger Prozessen im Jahr 1946 im internationalen Bewusstsein verankert waren, blieb die Forschung über diese Ereignisse viele Jahre auf einem oberflächlichen Niveau. In der so genannten deutschen Nachkriegsveteranenliteratur finden sich einige wenige Berichte, die die Beteiligung ihrer Urheber nicht reflektieren. Diese Berichte befassen sich mit der Geschichte der Divisionen und einiger kleinerer Einheiten, die an den Deportationen beteiligt waren.
Deutsche Historiker:innen begannen erst viel später, sich mit diesen Ereignissen zu befassen, obwohl keine vergleichbare Operation der Wehrmacht gegen die russische Zivilbevölkerung je dokumentiert worden war. Einen ersten Versuch der Analyse unternahm der DDR-Historiker Norbert Müller, der 1971 auf der Grundlage sowjetischer Dokumente auf die Deportationen einging. Ihm folgte Christian Gerlach, der sowohl in seiner Dissertation als auch in einem Aufsatz über die Verbrechen der deutschen Fronttruppen in Belarus von 1941 bis 1944 vor allem sowjetische Archive und verstreute deutsche Unterlagen nutzte. Gerlach bezog jedoch die vorhandenen deutschen Einsatzdokumente nicht vollständig in seine Analyse ein. Der von Hans-Heinrich Nolte gegebene kurze Überblick enthält nur wenige Details. Insbesondere fehlen in seinem Quellenverzeichnis jegliche Wehrmachtsunterlagen. Er bezieht jedoch wichtige Quellen aus den belarusischen Archiven ein. Keiner der beiden Autoren konnte sich also ein umfassendes Bild von der Strukturierung und dem vollen Ausmaß dieses Kriegsverbrechens machen.
Christoph Rass hat die Vorgänge in Azaryčy auf der Grundlage eines sehr großen Teils der vorhandenen Akten in deutschen Archiven untersucht. Seine Darstellung offenbart schließlich die „Anatomie“ eines der größten Kriegsverbrechen der Wehrmacht an der Ostfront und zeigt, dass es sich um die Summe mehrerer zentral geplanter und koordinierter Einzelaktionen handelte, die in einer komplexen kriminellen Operation gipfelten. Auf dieser Grundlage wurde 2006 ein unveröffentlichter Dokumentarfilm erstellt. Der Film ergänzte die vorhandenen Quellen mit neuen Zeitzeugeninterviews und weiteren dokumentarischen Erkenntnissen und lieferte so erstmals eine umfassende audiovisuelle Dokumentation des Verbrechens und des Tatortes. Das USHMM verfügt über eine Kopie dieses Films.
- Baumann, Hans: Die 35. Infanterie-Division im Zweiten Weltkrieg 1939-1945, Karlsruhe 1964.
- Beyersdorff, Ernst: Geschichte der 110. Infanteriedivision. Bad Nauheim 1965.
- Gerlach, Christian: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburg 2000.
- Gerlach, Christian: Verbrechen deutscher Fronttruppen in Weißrussland 1941-1944, in: Pohl, Karl Heinrich (Hg.): Wehrmacht und Vernichtungspolitik: Militär im nationalsozialistischen System. Göttingen 1999, S. 89-115.
- Großmann, Horst: Geschichte der rheinisch-westfälischen 6. Infanterie-Division, Bad Nauheim 1958. Haupt, Werner: Geschichte der 134. Infanteriedivision. Tuttlingen 1971.
- Hinze, Rolf: Bug, Moskwa, Beresina. Der Weg eines bespannten Artillerieregiments im 2. Weltkrieg bis zum Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte. Düsseldorf 1978.
- Hinze, Rolf: Hitze, Frost und Pulverdampf: der Schicksalsweg der 20. Panzer-Division. Bochum 1981.
- Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg (Hg.): Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Band VII, Verhandlungsniederschriften 5. Februar 1946 Februar 1946. Nürnberg 1947.
- Juhnke, Hans-Joachim: Auswertung des Fleckfiebergeschehens im Landheer der faschistischen Wehrmacht in der Periode des 2. Weltkrieges und seine mögliche Rolle in einem modernen Krieg. Diss. Greifswald (DDR) 1967.
- Kameradendienst 35. ID (Hg.): Die 35. Infanteriedivision im Einsatz 1939-1945 in Frankreich – Russland. Friedberg 1984.
- Knatko, Galina D. u. a. (Hg.): Geiseln der Wehrmacht. Dokumente und Belege. Minsk 1999.
- Leven, Karl-Heinz: Fleckfieber beim deutschen Heer während des Krieges gegen die Sowjetunion (1941-45), in: Guth, Ekkehart (Hg.): Sanitätswesen im Zweiten Weltkrieg. Herford 1990, S. 127-166.
- Mehner, Kurt (Hg.): Die geheimen Tagesberichte der Deutschen Wehrmachtführung im Zweiten Weltkrieg 1939 – 1945: die gegenseitige Lageunterrichtung der Wehrmacht-, Heeres- und Luftwaffenführung über alle Haupt- und Nebenkriegsschauplätze: „Lage West“(OKW-Kriegsschauplätze Nord, West, Italien, Balkan), „Lage Ost“ (OKH) und „Luftlage Reich“. Freiburg 1984.
- Messerschmidt, Manfred: Der Minsker Prozeß 1946. Gedanken zu einem sowjetischen Kriegsverbrechertribunal, in: Heer, Hannes (Hg.): Vernichtungskrieg: Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944. Hamburg 1995, S. 551-569.
- Müller, Norbert: Wehrmacht und Okkupation 1941-1944. Zur Rolle der Wehrmacht und ihrer Führungsorgane im Okkupationsregime des faschistischen deutschen Imperialismus auf sowjetischem Territorium. Berlin 1971.
- Müller, Norbert (Hg.): Okkupation, Raub, Vernichtung: Dokumente zur Besatzungspolitik der faschistischen Wehrmacht auf sowjetischem Territorium 1941 bis 1944. Berlin 1980.
- Neumann, Joachim: Die 4. Panzerdivision 1938-1943, Bonn 1985.
- Nolte, Hans-Heinrich: Osariči 1944, in: Gerd Ueberschär (Hg.): Orte des Grauens. Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Darmstadt 2003, S. 187-194.
- Perau, Josef: Priester im Heere Hitlers. Erinnerungen 1940-1945. Essen 1962.
- Rass, Christoph: „Menschenmaterial“: Deutsche Soldaten an der Ostfront. Innenansichten einer Infanteriedivision 1939–1945. Paderborn 2001, S 387-402.
- Rass, Christoph: Ozarichi 1944. Entscheidungs- und Handlungsebenen eines Kriegsverbrechens, in: Richter, Timm C. (Hg.): Krieg und Verbrechen. Situation und Intentio., München 2006, S. 197-207.
- „Stalinskij Udar“, in: Ezhednevnaja krasoarmejskaja gazeta, March 23 1944, April 20 and 22 1944.
- Tessin, Georg (Hg.): Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945, 17 Bände. Osnabrück 1967-2002.
- Plato, Anton D.: 5. Panzerdivision 1938-1945. Reutlingen 1998.
- Ueberschär, Gerd R.: Die sowjetischen Prozesse gegen deutsche Kriegsgefangene 1943-1952, in: idem (Hg.): Der Nationalsozialismus vor Gericht. Die alliierten Prozesse gegen Kriegsverbrecher und Soldaten 1943-1952. Frankfurt a. M. 1999, S. 240-261.
- von Saucken, Dietrich: 4. Panzer-Division: Divisionsgeschichte. Aschheim vor München 1968.
- Weindling, Paul Julian: Epidemics and Genocide in Eastern Europe 1890-1945. Oxford 2000.
_________________________________________________________________________________________________________________________
[i] Befragung Generalleutnant Johann Georg Richert, 16. Januar 1946, S. 37, Privatarchiv Paul Kohl, Berlin.
[ii] Befehl über die Aufstellung von Arbeitsabteilungen, 23.5.1943, NARA T-314 Film 688 Frame 1235; für weitere
Information zu Harpe, siehe BA MA Msg 109/946.
[iii] Berat. Hyg. Prof. v. Bormann, 9. Armee, Erfahrungsbericht Fleckfieber 31.12.1943-15.5.1943; Erfahrungsbericht Fleckfieber-Evakuierung 31.12.1943-15.5.1943, BA MA H 20 5 8.
[iv] Sicherheitspolizei und SD, Sonderkommando 7a, geh.Tg.B.Br. 17/44g ,30.3.1944, NARA T-314 Film 1440 Frame 990. 5
[v] Kriegstagebuch der Quartiermeisterabteilung des LVI. Korps, 9.3.1944, NARA T-314 Film 1438 Frame 914.
[vi] Vgl. Fußnote 5.
[vii] Kriegstagebuch der Quartiermeisterabteilung des LVI. Korps, 16.3.1944, NARA T-314 Film 1438 Frame 922.
[viii] Vgl. Fußnote 4.
[ix] Protokoll Nr. 29. Sitzung der Außerordentlichen Staatlichen Kommission vom 29. April 1944, Staatsarchiv Nürnberg, Dokument USSR-4.
[x] Vgl. Fußnote 1.
[xi] Vgl. Fußnote 9.
[xii] Vgl. Fußnote 4.
[xiii] Vgl. Fußnote 7.
[xiv] Erfahrungsbericht über den Abschub nichtarbeitsfähiger Zivilisten zum Feind, 28.3.1944, BA MA RH 20 9 197; siehe weiter Fußnote 4.
[xv] Vgl. Fußnote 1.
[xvi] Vgl. Fußnote 4.
[xvii] Vgl. Fußnote 5.
[xviii] Perau, Josef: Priester im Heere Hitlers. Erinnerungen 1940-1945, Essen 1962, S. 160.
[xix] Vgl. Fußnoten 4, 9 und 14; sowie Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Bd. VIII. Verhandlungsniederschriften 5. Februar 1946-19. Februar 1946, Nürnberg 1947, S. 635.
[xx] Vgl. Fußnote 19.